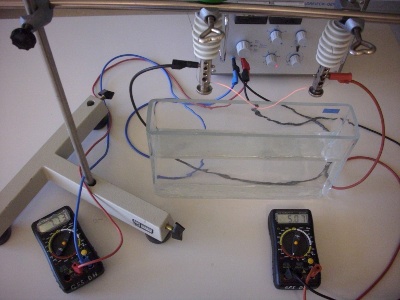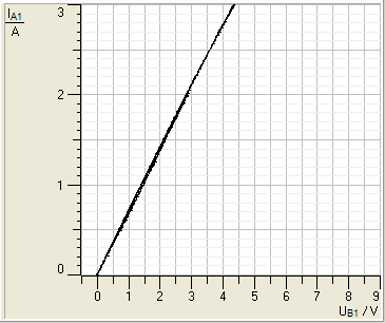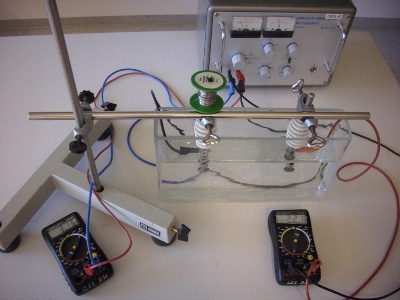Unterrichtseinsichten - Schuljahr 2012/2013 - Physik 9e
Halbleiter
2013-01-11
- Gute elektrische Leiter sind z.B. Kupfer, Silber und Gold
Aus Kostengründen wird für Kabel meistens Kupfer
eingesetzt.
- Nichtleiter (also Materialien, die den elektrischen Strom
(fast) nicht leiten) sind z.B. Kunststoffe, Stein, Glas,
Porzellan.
- Die Gruppe der Stoffe, die von ihren Leitungseigenschaften
zwischen Leitern und Nichtleitern liegt, nennt man Halbleiter.
Seit gut 50 Jahren kommt man ohne diese Halbleiter (z.B.
Silizium und Germanium) nicht mehr in der Technik aus.
Kompakte Computer, Radios, Fernseher, Telefone, Taschenrechner
usw. sind ohne Halbleiter nicht vorstellbar.
- Auch als Energiewandler werden Halbleiter immer wichtiger. Beispiel:
Mit Hilfe von Solarzellen (Fotovoltaik) wird Licht in
Energie umgewandelt.

Fällt Licht auf eine Solarzelle, so kann man an den
beiden Anschlüssen der Solarzelle eine Spannung messen,
die von der Lichtintensität abhängig ist.
- Bei der Schaltung mehrerer Solarzellen muss man auf die Polung achten.
Werden zwei Solarzellen gegeneinander geschaltet, so ergibt sich die
Spannung 0V, ähnlich so, als wenn man zwei Batterien gegeneinander
schaltet (+ an + oder - an -).
Wir haben das im Schüler-Versuch gesehen: Während 1
Solarzelle die Spannung 0,2V lieferte, lieferten 3 richtig
hintereinandergeschaltete Zellen die Spannung 0,2V+0,2V+0,2V=0,6V.
Wurde aber eine Zelle gedreht, so ergab sich 0,2V-0,2V+0,2V=0,2V.
- Die Spannung gibt den Elektronenüberschuss am Minuspol gegenüber dem Pluspol an.
Fließt auf Grund der Spannung ein Strom in einem geschlossenen
Stromkreis, so verringert sich wegen der bewegten Elektronen der
Elektronenüberschuss am Minuspol, d. h. die Spannung sinkt,
Spannungsabfall genannt.
Je kleiner der Widerstand im Stromkreis, desto größer ist
der Spannungsabfall. Z. B. wird das Licht einer Lampe dunkler, wenn man
parallel einen großen Stromverbraucher wie einen Wasserkocher
oder ein Bügeleisen anstellt.
- Eine Solarzelle kann man also nicht bei der maximalen Spannung betreiben, die ohne einen Verbraucher angezeigt wird.
Wie sollte man dann den Widerstand in dem Stromkreis wählen, damit
die Spannung nicht zu sehr sinkt (obwohl dadurch die Stromstärke
steigt) und nicht zu groß bleibt (da dann die Stromstärke zu
klein wird)?
- Die Leistung P (auch Energiestromstärke genannt) errechnet
sich aus dem Produkt von Spannung und Stromstärke: P=U·I.
Für den besten Betriebspunkt (MPP [maximal power point] genannt)
berechnet man für alle Spannungen (und den zugehörigen
Stromstärken) die Leistung und sucht dann die Spannung mit der
größten Leistung heraus.
- Hier ein Beispiel:
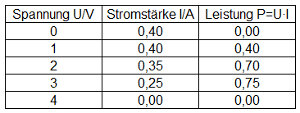
Der Graph zu dieser Messreihe zeigt, dass der MPP zwischen 2,5 V und 3,0 V liegt.

2013-01-18
- Versuche zu LEDs an verschiedenen Stationen:
- LEDs sind tatsächlich Dioden, d. h. der Strom kann nur in einer Richtung durch eine LED fließen.
Wird eine LED an einem Dynamo betrieben, so flackert sie (bei langsamen
Drehen), da der Dynamo Wechslstrom erzeugt. Nur bei der richtigen
Stromrichtung leuchtet die LED.

- LEDs kann man als Solarzelle betreiben: Fällt Licht auf eine LED, so wird eine Spannung an den Enden erzeugt.
- Wichtig ist: LEDs müssen immer mit einem Vorwiderstand betrieben werden:

- Genaue Ergebnisse mit theoretischen Hintergründen in der nächsten Stunde.
2012-01-25
- In den letzten Stunden haben wir Solarzellen und LEDs untersucht.
Solarzellen wandeln Licht-Energie in elektrische Energie um.
LEDs wandeln elektrische Energie in Licht-Energie um.
Ein Beispiel dafür, dass in der Natur vielfach (aber nicht immer!) Vorgänge umkehrbar ablaufen.
- Wiederholung zur E-Lehre
Es wird untersucht, wie sich die Stromstärke in einem dünnen
Metalldraht ändert, wenn man unterschiedliche Spannungen anlegt.
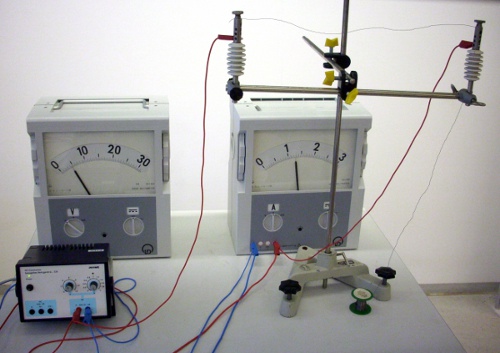
Zunächst wurde ein Konstantandraht zwischen den Stielklemmen gespannt.
Messergebnis und Auswertung:

Wir sehen, dass die Messpunkte auf einer Ursprungsgerade liegen (der y-Achsenabschnitt 0,008 ist vernachlässigbar klein).
Die Gleichung lautet (gerundet)  .
.
U und I sind also proportional zueinander: U~I
Meistens schreibt man die zugehörige Gleichung mit dem Proportionalitätsfaktor vor dem I.
Wegen  ergibt sich
ergibt sich  . Es folgt also die Gleichung
. Es folgt also die Gleichung  .
.
Den Proportionalitätsfaktor nennt man Widerstand.
- Bei der zweiten Messung wurde statt des Konstantandrahts ein Eisendraht verwendet.
Messergebnisse und Graph:

- Abhängigkeit des Widerstandes von der Temperatur eines Eisendrahtes:
- Ein Eisendraht wird bis zur Rotglut erhitzt. Dabei wird ein U-I-Diagramm aufgenommen:

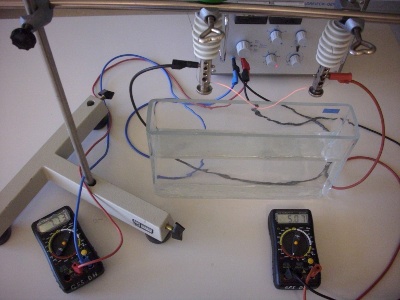
Bei
steigender Temperatur wird der Widerstand des Drahtes
größer. Die Stromstärke steigt bei steigender Spannung
nicht mehr so stark wie bei kleinen Spannungen.
- Wird der Eisendraht im Wasserbad gekühlt, ergibt sich folgendes U-I-Diagramm:
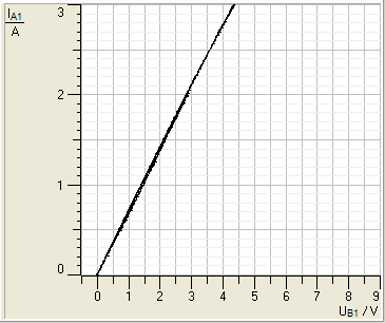

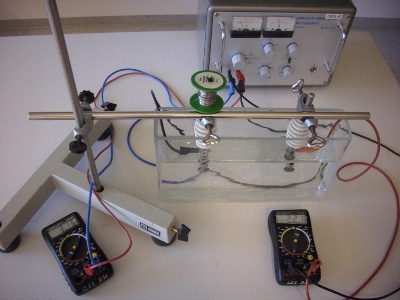
Da die Temperatur konstant bleibt, gilt das Ohmsche Gesetz U~I. Es ergibt sich im Schaubild also eine Ursprungs-Gerade.
- Wenn
die Temperatur konstant ist, gilt bei Drähten das Ohmsche Gesetz
U~I (Die Spannung ist proportional zur Stromstärke).
- Die
untersuchten Drähte aus Konstantan und Eisen nennt man Kaltleiter,
weil sie in kaltem Zustand besser leiten als in heißem Zustand.
Beim Konstantandraht merkt man das nur nicht, weil er aus einer
Legierung besteht, bei der die einzelnen Bestandteile so gewählt
sind, dass sich im "normalen" Messbetrieb die Temperatur nicht auf den
Widerstand auswirkt.
- Zur Frage, was einen Halbleiter zum Halbleiter macht, haben wir uns den inneren Aufbau eines Siliziumkristalls angeschaut.
Die Silizium-Atome haben 4 Valenzelektronen. Lagern sich 4 andere
Silizium-Atom um ein Silizium-Atom herum an, so wird von jedem dieser
Atome 1 Atom "entliehen", um mit dann 8 Außenelektronen
Edelgaskonfiguration zu erreichen.
In einem Atomgitter, in dem jedes Silizium-Atom 4 Nachbarn hat, werden
also alle Elektronen zur Bindung benötigt und es steht kein
Elektron zum Ladungstransport bereit - so jedenfalls in der Theorie
(und am absoluten Nullpunkt). Weiteres in der nächsten Stunde.
- In Simulationen haben wir erarbeitet, wie Kaltleiter (vermehrte
Atombewegung beim Erhitzen bewirkt einen höheren Widerstand) und
Heißleiter (vermehrte Energiezufuhr bewirkt, dass sich weitere
Valenzelektronen lösen und zum dann vergrößerten
Stromfluss beitragen) bei unterschiedlicher Temperatur mit der
Änderung des Widerstands reagieren.
- Das Dotieren von Halbleitern wurde angesprochen und wird in der nächsten Stunde vertieft.
2013-02-05
- Mit dem Energie-Bändermodell kann man die Leitungseigenschaften bei Halbleitern, Leitern und Nichtleitern deuten.
- Durch Dotieren (=Einbringen von Fremdatomen) wird ein Halbleiter zu einem n-Halbleiter (Atome mit 5 Valenzelektronen werden eingefügt - das 5. Elektron dient zum Ladungstransport) oder zu einem p-Halbleiter
(Atome mit 3 Valenzelektronen werden eingefügt - das fehlende 4.
Elektron dient als positive Ladung zur Löcherleitung).
- Werden ein n- und ein p-Halbleiter zusammengebracht, so spricht man von einer Diode, weil der Strom nur in einer Richtung durch die beiden Halbleiter fließen kann.
Wir haben eine Diode auf diese Eigenschaft hin untersucht:


Das Oszilloskop zeigte eine Halbwelle der Wechselspannung dann, wenn
die Diode gesperrt hat und eine Nulllinie, wenn die Diode in
Durchlassrichtung gepolt war.
2013-02-12
- Wiederholung zu "Halbleitern"
- Silizium und Germanium sind "eigentlich" Nichtleiter, wenn sie
in reiner Kristallform vorliegen, da alle 4 Valenzelektronen für
die Bindung benötigt werden.
- Sie werden zu Halbleitern durch
- Erwärmung (Elektronen werdne frei gesetzt) oder durch
- Dotieren (Ersetzen von Si- und Ge-Atomen durch Atome mit 3 oder 5 Valenzelektronen (3: p-Halbleiter ; 5: n-Halbleiter)
- Bei Halbleiterdioden muss in Durchlassrichtung eine kleine Spannung (ca. 0,6 V) anliegen, damit ein Stromfluss einsetzt.
In Sperrrichtung kann auch ein Strom fließen, wenn die Spannung
einen bestimmten höheren Wert überschreitet (ca. 50 V).
- Anwendung:
Ihr solltet aus 2 Lampen, 4 Gleichrichterdioden und 2 Schaltern eine
Schaltung aufbauen, bei der der Bereich der Schalter mit dem Bereich
der Lampen nur durch 2 Kabel verbunden ist und durch das
Schließen eines Schalters jeweils nur eine Lampe an- oder
ausgeschaltet wird.
weiter mit Energieübertragung

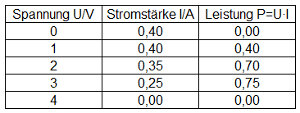



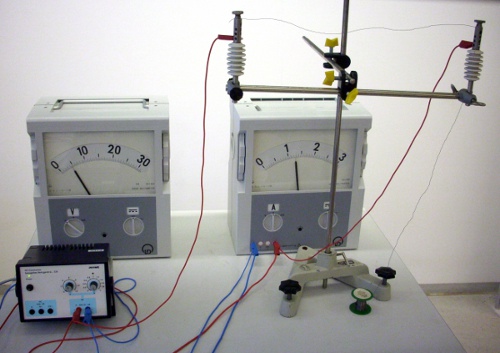

 .
. ergibt sich
ergibt sich  . Es folgt also die Gleichung
. Es folgt also die Gleichung  .
.