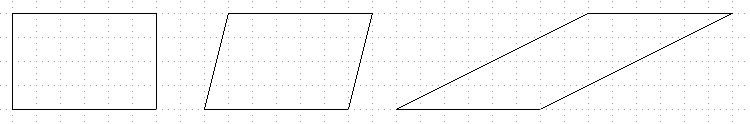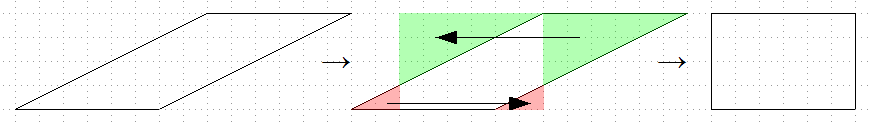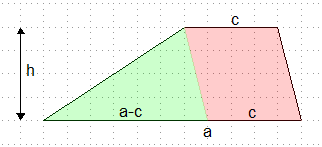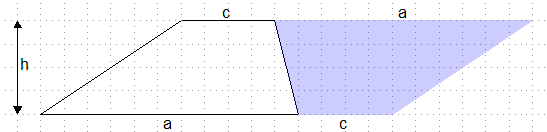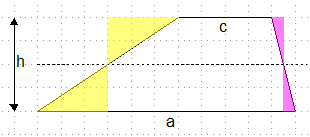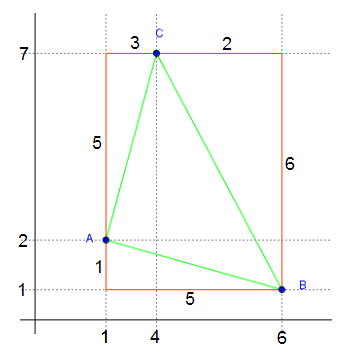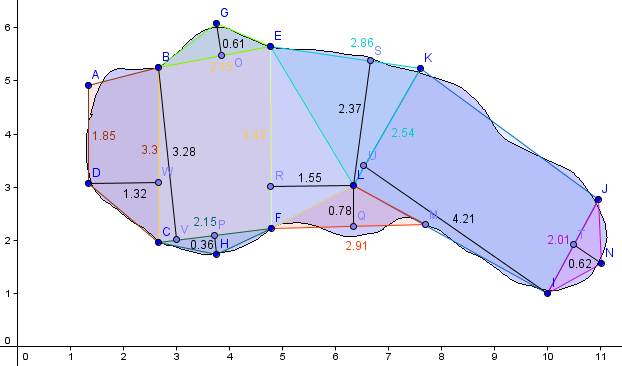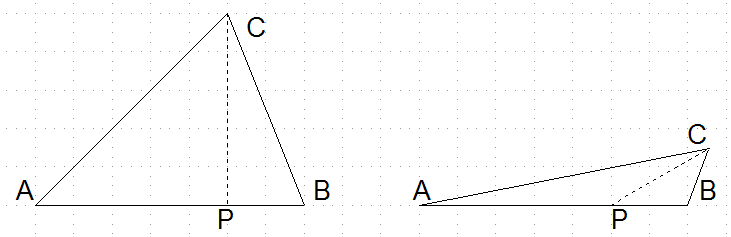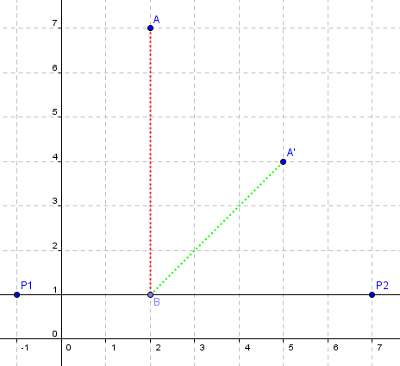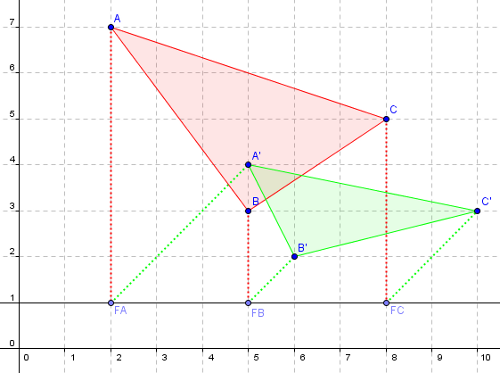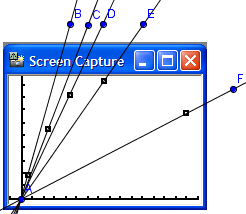Unterrichtseinsichten
- Schuljahr 2008/2009 - Mathematik 7d
Berechnungen an Vielecken und
Prismen
2009-01-07
- Aus einem breiten Pappstreifen sollen Einladungskarten geschnitten werden.
Um nicht immer das "langweilige" Rechteck-Format zu benutzen, sollen die Karten eine Parallelogramm-Fläche erhalten.
Braucht
man mehr oder weniger oder gleich viel Pappe gegenüber dem
Rechteckformat, wenn die Länge der Karte gleich bleibt?
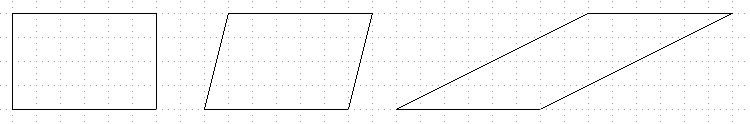
Bedingungen sind also: - waagrechte Seite immer gleich lang,
- schräge Seiten dürfen unterschiedliche Länge haben,
- gegenüberliegende Seiten müssen parallel sein,
- die Breite des Streifens, also die Höhen der Parallelogramme, müssen gleich sein.
- Zur
Lösung der Frage haben wir zuerst die Anzahl der quadratischen
Kästchen innerhalb der Parallelogramme gezählt.
Ganze
Quadrate sind gelb eingezeichnet, Teilfiguren, die sich zusammen zu
einem Quadrat ergänzen, sind in gleicher Farbe dargestellt.

links: 24 ganze Quadrate
Mitte: 20 ganze Quadrate und 4 zusammengesetzte Quadrate ergeben 24 ganze Quadrate
rechts: 16 ganze Quadrate und 8 zusammengesetzte Quadrate ergeben 24 ganze Quadrate.
Folgerung: der Flächeninhalt bleibt gleich, ganz gleich wie schräg die Seitenkanten der Parallelogramme auch sind. - Ihr habt dann auch herausgefunden, warum das so sein muss:
"Wenn man an der einen Seite etwas wegschneidet, passt das genau an der anderen Seite". - Schneidet
man zum Beispiel bei der mittleren Figur das eingefärbte Dreieck
rechts ab, kann man damit die Figur auf der linken Seite zu einem
Rechteck ergänzen, das genau so groß ist wie das linke
Rechteck:

- Bei der Figur rechts ist ein Schritt mehr notwendig:
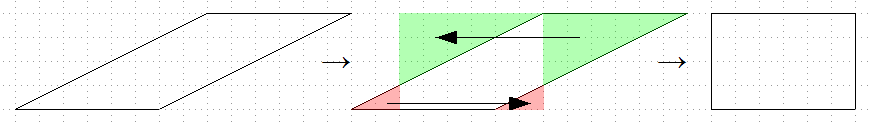
- Es gilt also: Der Flächeninhalt eines Parallelogramms berechnet sich aus "Grundseite mal Höhe".
Nachweis:
Man kann ein Parallelogramm immer durch Verschieben von seitlichen
Flächenstücken (parallel zur Grundseite) in ein Rechteck
umformen, für das zur Berechnung des Flächeninhaltes gilt:
"Grundseite mal Höhe". - Überprüfung mit einem Parallelogramm, bei dem jede der Seiten einmal die Grundseite ist.
Mit diesem GeoGebra-Arbeitsblatt kann man sich die Arbeit des Zeichnens und Rechnens abnehmen lassen:

2009-01-09
- Die Aufgabe zum Ornament war anscheinend für Euch sehr schwer. Deshalb hier einige Tipps zur Lösung.
Für die Hausaufgabe müsst Ihr mit anderen Werten rechnen (siehe Buch)!

- Die gelben Abschnitte sind Parallelogramme (das habt Ihr schon gefunden).
- Die Fläche eines Parallelogramms berechnet man durch "Grundseite mal Höhe".
- Elisa kam darauf, dass man einen Teil des Ornaments für sich betrachten kann, der auch ein Parallelogramm darstellt.

Dieses Parallelogramm enthält 2 gelbe und 2 rote Flächenstücke.
Mit den angegebenen Werten kann man nun die notwendigen Berechnungen durchführen.
2009-01-12
- Besprechung der Hausaufgabe (siehe Aufgabe vom 2009-01-09)
- Flächenbestimmung bei einem Dreieck.
Ihr habt gut das beim Parallelogramm Erlernte auf die Berechnung am Dreieck übertragen!
Ein Dreieck mit der Grundseite a und der Höhe ha besitzt den Flächeninhalt A=1/2·a·ha .
Hier eine Auswahl der Zeichnungen, mit denen Ihr das Ergebnis gefunden habt:

2009-01-13
- Besprechung der Hausaufgabe und weitere Übungen zur Flächenberechnung beim Dreieck.
2009-01-14
- Flächenbestimmung bei einem Trapez (ein Trapez ist ein Viereck, bei dem mindestens 2 Seiten zueinander parallel sind)
Eure Vorschläge zur Berechnung der Formel: 
An
das Trapez wird an einer Seite ein Dreieck mit der Grundseite a-c und
der Höhe h angesetzt, sodass sich insgesamt ein Parallelogramm mit
Grundseite a und Höhe h ergibt.
Flächeninhalt des
Parallelogramms minus Flächeninhalt des Dreiecks ergibt dann
den Flächeninhalt des Trapezes:
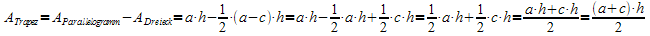
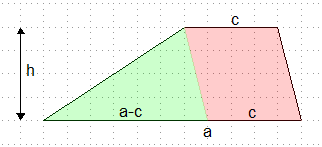
Das
Trapez wird aufgeteilt in ein Dreieck (grün) mit der Grundseite
a-c und der Höhe h und in ein Parallelogramm (rot) mit der
Grundseite c und der Höhe h.
Die Summe aus dem
Flächeninhalt des Dreiecks und dem Flächeninhalt des
Parallelogramms ergibt den Flächeninhalt des Trapezes:

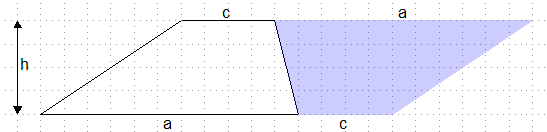
Das
Trapez wird um die Mitte der rechten schrägen Seite um 180°
gedreht. Dann entsteht ein Parallelogramm mit der Grundseite a+c und
der Höhe h.
Nimmt man von diesem Parallelogramm die Hälfte
des Flächeninhaltes, so erhält man den Flächeninhalt des
Trapezes:

- ... und wie wäre es mit dieser Aufteilung des Trapezes?
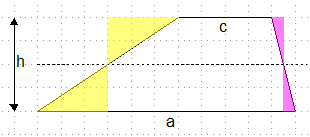
Wie lang ist die Grundseite des entstehenden Rechteckes?
2009-01-15
- Flächeninhalt eines Vieleckes

Nach
einigen Überlegungen habt Ihr mehrheitlich vorgeschlagen, das
gegebene 5-Eck in 3 Dreiecke zu zerlegen und die Flächen dieser
Dreiecke zu bestimmen.
Eure Ergebnisse waren 25,58 ; 25,31 ; 25,47 ;
23,61 ; 24,76 ; 25,28 ; 26,50 ; 24,16 ; 24,84 ; 25,16. Hausaufgabe:
Mittelwert berechnen. - Haben wir mit dem Mittelwert den wahren Flächeninhalt?
Die
gegebenen Eckpunkt haben alle ganzzahlige Koordinaten. Ob man damit
nicht auch einen exakten Wert berechnen kann, ohne sich auf ungenaue
Messungen verlassen zu müssen?
Dazu mehr in der nächsten Stunde.
2009-01-16
- Als Mittelwert ergibt sich bei der Flächenbestimmung aus Euren Messwerten 25,07.
Ist das der exakte Wert des Flächeninhalts? Wahrscheinlich nicht.
Welches ist denn der exakte Wert? Vielleicht genau 25? - Ein sehr einfaches Vorgehen zur Bestimmung des genauen Wertes haben wir heute kennen gelernt:
Man
umschließt das Vieleck durch ein Rechteck, berechnet den
Flächeninhalt dieses Rechteckes und subtrahiert davon die
Flächeninhalte der Flächen, die im Rechteck, aber nicht in
der zu berechnenden Fläche sind:

Flächeninhalt des Rechteckes (roter Rahmen): 8·6=48
Flächeninhalt
der einzelnen Flächen (grün): A1-->5,0 ; A2-->6,0 ;
A3-->4,0 ; A4-->3,0 ; A5-->4,5 , zusammen 22,5
Flächeninhalt des 5-Eckes (rötlich): 48 - 22,5 = 25,5 - Der Mittelwert Eurer Messungen bzw. Rechnungen war schon sehr gut!
Ihr
seht aber, dass man sich auf Messungen nicht unbedingt verlassen
kann, auch wenn man mit mehreren zusammen misst und rechnet.
Die
Methode mit dem umgebenden Rechteck kann man auch auf alle
möglichen anderen Flächen anwenden, die durch gerade Strecken
begrenzt werden.
2009-01-19
- Als Hausaufgabe war der Flächeninhalt des Dreiecks mit den Eckpunkten A(1/2), B(6/1) und C(4/7) zu berechnen.
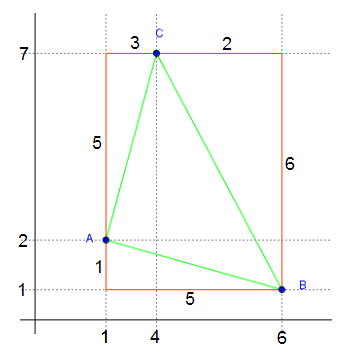
An
einer nicht maßstabsgerechten Zeichnung haben wir gesehen, dass
man mit der Methode des "Um-Rechteckes" durch Rechnung ein exaktes
Ergebnis erhalten kann: - Flächeninhalt des Rechteckes: 5·6=30
- Flächeninhalt des Dreieckes links oben: 5·3/2=7,5
- Flächeninhalt des Dreieckes rechts oben: 6·2/2=6,0
- Flächeninhalt des Dreieckes unten: 5·1/2=2,5
- Gesamtflächeninhalt der äußeren Dreiecke: 7,5+6,0+2,5=16,0
- Flächeninhalt
des grünen Dreieckes = Flächeninhalt des Rechteckes -
Flächeninhalt aller äußeren Dreiecke = 30 - 16 = 14
Durch
Abmessen (Grundseite mal Höhe durch 2) auch bei sehr genau
gezeichnetem grünen Dreieck haben viele von Euch nicht dieses
exakte Ergebnis erhalten.
2009-01-21
- Besprechung der Hausaufgabe
Achtet beim Umformen von Einheiten darauf, ob Ihr eine einfache Einheit oder eine Einheit zum Quadrat habt.
Beispiel: 1m = 100cm, aber 1m2 = 10000cm2, weil 1m2 = 1m·1m = 100cm·100cm = 10000cm2.
2009-01-23
- Flächeninhaltsbestimmungen
bei Flächen mit gekrümmten Begrenzungen werden erst in der
11. und 12. Klassenstufe besprochen (Integralrechnung).
Näherungsweise
können wir aber solcher Flächeninhalte auch mit Hilfe
der bekannten 3- und 4-Ecke abschätzen.
Beispiel:
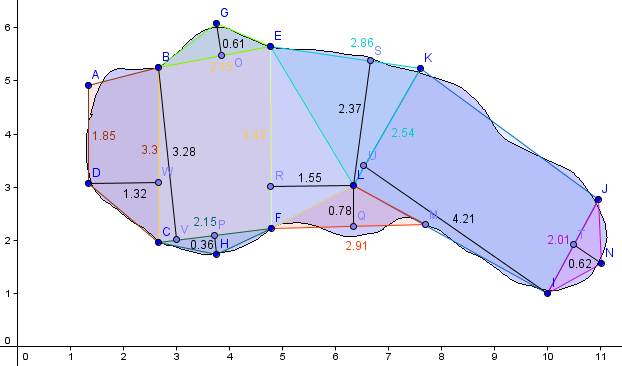
Die
Fläche eines Sees wird durch Dreiecke und Trapeze abgedeckt und
die Flächeninhalte dieser Figuren werden berechnet: - Trapez AABCD = (1,85+3,3)·1,32/2 = 3,399
- Trapez ABCFE = (2,15+2,15)·3,28/2 = 7,052
- Dreieck ABEG = 2,15·0,61/2 = 0,656
- Dreieck ACHF = 2,15·0,36/2 = 0,387
- Dreieck AFLE = 3,43·1,55/2 = 2,658
- Dreieck AELK = 2,86·2,37/2 = 3,389
- Dreieck AFML = 2,91·0,78/2 = 1,135
- Trapez ALIJK = (2,54+2,01)·4,21/2 = 9,578
- Dreieck AINJ = 2,01·0,62/2 = 0,623
- Gesamtfläche: 3,399+7,052+0,656+0,387+2,658+3,389+1,135+9,578+0,623 = 28,878
Steht eine Einheit für die Länge 1km, so hat der See etwa eine Fläche von 28,88km2 .
2009-01-26
- Konstruktion von Schrägbildern.
Vorgehensweise:
Die Strecken, die senkrecht in die Papierebene hinein gezeichnet werden
müssten und die deshalb (bis auf einen Punkt) nicht sichtbar
wären, werden unter einem bestimmten Winkel schräg zu einer
waagrechten Achse und um einen Faktor k verkürzt gezeichnet. Alle
in der Zeichenebene liegenden Strecken werden genau ihren Maßen
entsprechend gezeichnet. - In folgender Abbildung wird das
Dreieck ABC (links) um 90° nach hinten gekippt, so dass nur noch
die Seite AB zu sehen sein würde.
Stattdessen wird aber die
Strecke PC (die nach dem Kippen senkrecht nach hinten verlaufen
würde) unter einem Winkel von 30° zur Strecke AB und
verkürzt (mit dem Streckfaktor 3/5) gezeichnet.
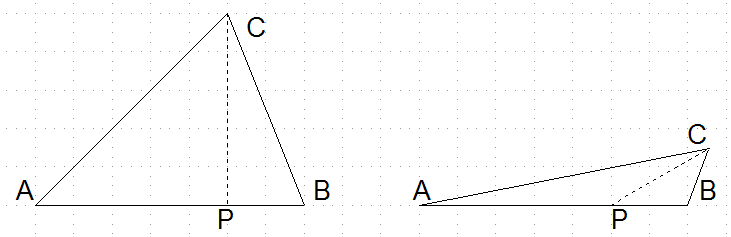

Man sieht das rechte Dreieck so, als ob man von schräb rechts oben darauf blicken würde.
Vergleiche
die Tischplatte, die in Wirklichkeit quadratisch ist. Die rechte Kante
ist verkürzt dargestellt. Auf Grund des seitlichen Abstandes ist
der Winkel der linken Tischkante zur Waagrechten kleiner als der Winkel
der rechten Tischkante. Bei unseren mathematischen Konstruktionen
wählen wir alle Neigungswinkel gleich.
2009-01-27
- Vereinfachtes Zeichnen eines Schrägbildes auf Kästchen-Papier
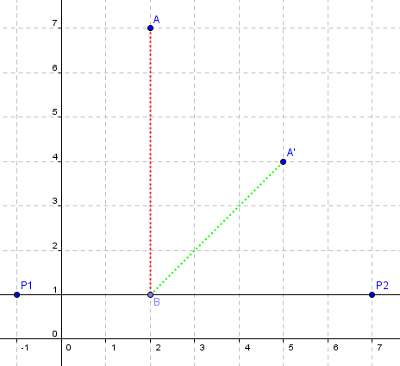
Soll
der Punkt A abgebildet werden, so wählt man zunächst eine
waagrechte, auf dem Koordinatengitter verlaufende Grundlinie.
Von A wird eine Senkrechte Strecke bis zur Grundlinie im Punkt B gezeichnet (rot).
Von B aus wird diagonal (45° zur Grundlinie) ein Strahl gezeichnet.
Man
misst aus, wie viel Kästchen Abstand die beiden Punkte A und B
haben. A' und B haben dann einen Abstand, der der Hälfte dieser
Kästchenzahl entspricht und in Quadrat-Diagonalen gemessen wird.
In unserem Beispiel: Zwischen A und B befinden sich 6
Kästchen-Längen. Dann muss B von A' den Abstand "3-mal eine
Kästchen-Diagonale" haben. - Beispiel für das
Schrägbild eines Dreiecks. Das rote Dreieck wird um 90° nach
hinten geklappt. Dadurch würde man nur noch einen Strich sehen. Im
Schrägbild dagegen kann man das Dreieck (grün) so sehen, als
wenn von links oben eine Lampe durch das rote Dreieck scheinen
würde und einen grünen Schatten auf der gedachten waagrechten
Ebene bilden würde.
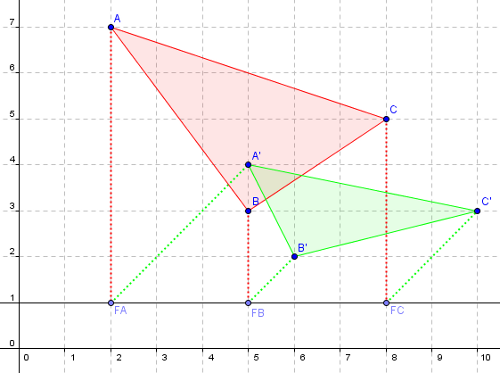
- Prismen sind Körper, die aus zwei kongruenten Flächen bestehen, die parallel zueinander liegen.
Die entsprechenden Eckpunkte der beiden Flächen sind durch gleich lange, parallele Strecken miteinander verbunden.
Beispiel: 
2009-02-06
- Besprechung der Hausaufgabe und weitere Übungen zum Berechnen der Volumina von Prismen (V=G·h).
2009-02-09
- Besprechung der Hausaufgabe.
- Bei
der Aufgabe zu den Parfum-Fläschchen haben wir gesehen, wie man
den Taschenrechner geeignet zum Finden der Lösung einsetzen kann:
- Mit Stat>Edit wird der Listeneditor aufgerufen.
- In L1 werden die Parfum-Mengen jeder Packung eingetragen.
- In L2 werden die Packungs-Volumina eingegeben durch Länge·Breit·Höhe
- In
L3 wird in der Kopfspalte L1/L2 eingegeben. Damit wird für alle
Parfum-Packungen das Verhältnis von Parfum-Menge zu
Packungsgröße berechnet.

- Werden
die Listeninhalte von L1 und L2 so dargestellt, dass die L1-Werte auf
der waagrechten und die L2-Werte auf der senkrechten Achse abgetragen
werden, so ergibt sich

Die Punkte geben das Verhältnis von Ware zu Verpackungsgröße an:
Für 1, 2 oder 3 Packungen erhält man die 1-, 2- oder 3-fache Menge an Ware und an Verpackung.
Ware
und Verpackung für ein Produkt sind also proportional und
entsprechende Punkte in der graphischen Darstellung liegen auf einer
Ursprungsgerade:
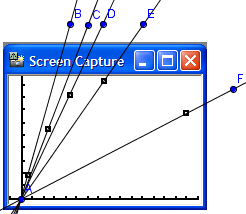
Für die Ware mit der flachsten Gerade gibt es am meisten Ware bezogen auf die Verpackungsgröße.
2009-02-10
- Weitere Übungen zum Berechnen von Prismen-Volumina.
- Zur
Erinnerung: Es ist manchmal einfacher, zu berechnende Flächen
nicht aufzuteilen und dann die Inhalte der Teilflächen zu
berechnen, sondern die zu berechnende Fläche in ein Rechteck zu
bringen, dessen Flächeninhalt zu berechnen und dann die Inhalte
der nicht vorhandenen Randflächen abzuziehen.
Zum besseren Verständnis hier ein Beispiel aus dem Unterricht:

- Mehrere haben die gelbe Fläche so zerlegt, wie es durch die gestrichelten Linien angedeutet wird.
Daraus ergaben sich folgende Berechnungsschritte: - Rechteck ganz links: 5·6=30
- Rechteck in der linken Mitte: 4·4=16
- Dreieck in der linken Mitte: 1/2·4·2=4
- Rechteck ganz rechts: 5·6=30
- Rechteck in der rechten Mitte: 4·4=16
- Dreieck in der rechten Mitte: 1/2·4·2=4
- insgesamt ist der Flächeninhalt also 30+16+4+30+16+4=100
- multipliziert mit der Länge des Werkstücks ergibt sich 100·18=1800
- Durch die Symmetrie der gelben Fläche kann man die Rechnung natürlich erheblich vereinfachen.
- Andere
Methode: Die gelbe Fläche zu einem Rechteck ergänzen und dann
die Fläche des zu viel berechneten Dreiecks abziehen:
- Fläche Rechteck: 6·18=108
- Fläche Dreieck: 1/2·8·2=8
- Fläche Rechteck minus Fläche Dreieck: 108-8=100
- multipliziert mit der Länge des Werkstücks ergibt sich 100·18=1800
2009-02-11
- Besprechung der umfangreichen Hausaufgabe / Aufgabe für die Vertretungsstunde
2009-02-13
- Weitere Übungen zum behandelten Unterrichtsstoff.
- Zur Arbeit bitte die Seiten 127-128, 132-144, 146-158 wiederholen.
Themen:
2009-02-16 und 2009-02-17 und 2009-02-20
- Wiederholung zur Arbeit (2009-02-23).
2009-02-23
weiter mit Mehrstufige Zufallsexperimente