- Zufallsgröße
Wird jedem Ausgang eines Zufallsexperiments eine Zahl zugeordnet, so heißt die Funktion, die diese Zuordnung beschreibt "Zufallsgröße".
Zufallsgrößen bezeichnet man oft mit X , Y oder Z ohne oder X1, X2, X3, ... mit Index.
Die Werte (oder Realisationen) einer Zufallsgröße werden häufig mit k oder k1, k2, k3, ... bezeichnet. - Häufigkeitsverteilung einer Zufallsgröße
Wird in einem Zufallsversuch zu jedem Wert k einer Zufallsgröße X die relative Häufigkeit h(k) bestimmt, so heißt die Zuordnung von Wert der Zufallsgröße zu relativer Häufigkeit Häufigkeitsverteilung. - Wahrscheinlichkeitsverteilung oder kurz: Verteilung
Jedem Wert ki der Zufallsgröße X wird eine Wahrscheinlichkeit p(X=ki) zugeordnet. Die Zurodnungsvorschrift nennt man Wahrscheinlichkeitsverteilung oder einfach nur Verteilung. - kumulierte Wahrscheinlichkeitsverteilung
Wird in einer Tabelle nicht jeweils die Wahrscheinlichkeit p(X=ki), sondern die Summe von Wahrscheinlichkeiten p(X<=ki) gelistet, so nennt man dies kumulierte Wahrscheinlichkeitsverteilung.
Wir haben in 4 Gruppen jeweils 10-mal mit 5 Heftzwecken gewürfelt und dabei notiert, wie viele Heftzwecken in den beiden möglichen Lagen
In einer Tabelle wurde die relative Häufigkeit dafür aufgelistet, dass bei einem Wurf 1, 2, ... mal die Lage

Die 1. Zeile enthält lediglich eine Zählvariable für den Index.
Die 2. Zeile enthält die Zahl der schräg liegenden Heftzwecken.
Die 3. Zeile enthält die relativen Häufigkeiten für das Schrägliegen.
Die 4. Zeile enthält die kumulierte Häufigkeit für das Schrägliegen.
- h(X<=4) = 0,83
- h(X>=3) = 1 - h(X<3) = 1 - 0,275 = 0,725
- h(X=3) = h(X<=3) - h(X<=2) = 0,475 - 0,275 = 0,200






 für n=10, p=1/6 und k=4
für n=10, p=1/6 und k=4





 GRAPH
GRAPH 




 .
.
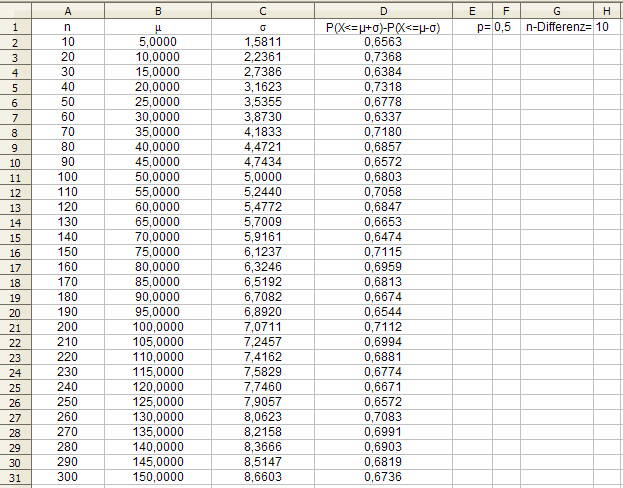


 hier am Beispiel γ=0,95.
hier am Beispiel γ=0,95.
 hier am Beispiel n=100, h=7/100
hier am Beispiel n=100, h=7/100
 Näherungswert 0 gibt die 1. Lösung p1=0,0343
Näherungswert 0 gibt die 1. Lösung p1=0,0343
 Näherungswert 1 gibt die 2. Lösung p2=0,1375
Näherungswert 1 gibt die 2. Lösung p2=0,1375